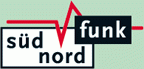südnordfunk #128
Gewaltsame Landnahme in West Papua // Gefährliche Nickelminen in Guatemala // Kurdische Perspektiven auf Syrien
Kurdische Perspektiven auf den Sturz Assads
Am 8. Dezember 2024 eroberten Rebellen fast kampflos die Hauptstadt Damaskus, stürzten die Regierung und beendeten damit die mehr als 50 Jahre andauernde Herrschaft der Familie Assad, die sich sogleich nach Moskau absetzte. Eine Diktatur mit all ihren Menschenrechtsverletzungen wie willkürliche Hinrichtungen, Staatsfolter in Foltergefängnissen, Unterdrückung von Minderheiten schienen von einem auf den anderen Tag ein Ende zu haben und die Freude auf den Straßen war groß. Doch wie wird sich das Land in Zukunft entwickeln? Wird es zu einer stabilen Demokratie? Der islamistische Interimsmachthaber Ahmed Al-Sharaa gibt sich betont gemäßigt und versöhnlich. Doch gerade viele Kurd*innen trauen dem Frieden nicht und schauen trotz ihrer Freude über den Sturz Assads eher besorgt auf die Zukunft.
Community Journalismus in Guatemala
Carlos Ernesto Choc ist Journalist, ist Maya Qèqchi und stammt aus der Stadt El Estor am Ausgang des Izabal-Sees im Osten Guatemalas. Er war am Projekt „Green Blood Mining Secrets“ beteiligt. Eine Studie über die Umweltschäden durch die Nickel Minen in Guatemala. Seine Berichte wurden in verschiedenen europäischen Medien veröffentlicht. Er ist Teil des internationalen Journalisten Netzwerkes Forbidden Stories mit Sitz in Paris. Gemeinsam mit unserem Kollegen Martin Schäfer von der LN trafen wir uns mit ihm Anfang Dezember 2024 zu einem Gespräch in unserem Berliner Büro, um uns über das Thema Comunity Journalismus und freie Medien auszutauschen.
Tribunal über gewaltsame Landnahmen in West Papua, Indonesien
Das in Rom ansässige Ständige Völkertribunal PPT organisiert regelmäßig internationale Tribunale. In diesem Jahr saß Indonesien auf der Anklagebank – wegen Landraub, gewaltsamer Unterdrückung, Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung in West Papua. Der Anwalt Leonardo Lijie ist einer der zentralen Zeugen im Verfahren. Magdalena Kafiar hat Menschenrechtsverbrechen in West Papua dokumentiert. Gemeinsam haben die beiden vor dem UN Menschenrechtsrat von den Vergehen der indonesische Regierung berichtet. Doch was bringt eine Gerichtsbarkeit außerhalb der von Indonesien anerkannten Rechtsinstitutionen?