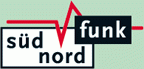# 89 Rap als Revolution, Zementindustrie in Togo
Der Musiker Général Valséro: Vom kamerunischen Gefängnis ins Zénith in Paris
Das ursprünglich für den 22. Mai 2021 geplante Konzert des kamerunischen Rappers Valséro fand am 18. September 2021 auf der Bühne des Zenith in Paris statt. Mehr als ein Konzert war es eine kamerunische Revolution oder wie es den Künstler und seine Fans genannt haben: ein Konzert für die Freiheit. Mit dem Titel, "Les loups sont de sortie" - die Wölfe sind unterwegs - versprach das Konzert, zahlreiche kamerunische und afrikanische Persönlichkeiten zu versammeln, die sich für eine politische Transition und eine neue Regierung im Land einsetzen.
Podiumsdiskussion: Kalk, Ton und Mondlandschaften
Die Zementproduktion ist für acht Prozent der jährlichen CO2-Emissionen verantwortlich. Um den begehrten Baustoff herzustellen, wird Kalk, Ton und Energie in großen Mengen benötigt. Ganze Landstriche werden durch den Kalkabbau zu Mondlandschaften. Wie im westafrikanischen Togo: Wo es in ihrer Kindheit noch grün war, fressen sich jetzt riesige Zementwerke in die Landschaft, erzählt die togolesische Journalistin Rouby Traoré. Auf der Podiumsdiskussion des südnordfunks im Colombipark sprach sie mit der Heidelberger Klimagerechtigkeitsaktivistin Yulika Tsuda über die ausbeuterischen Praktiken von HeidelbergCement und darüber, was diese mit kolonialen Kontinuitäten zu haben.
südnordfunk vom 01.10.2021 auf Radio Dreyeckland
(Quelle: # 89 Rap als Revolution, Zementindustrie in Togo — iz3w - informationszentrum 3. welt)